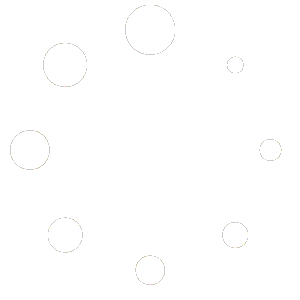Im ersten Teil haben wir die faszinierende Geschichte des DDR-Wollwunders entdeckt: Wie Deutschland einmal 6 Kilogramm Wolle pro Schaf produzierte und eine der führenden Wollnationen der Welt war – bis alles 1990 zusammenbrach.
Aber warum schafft es England bis heute, Weltklasse-Wolle zu produzieren? Und was können wir daraus für ein DACH-Comeback lernen?
England macht es richtig: Kontinuität als Erfolgsrezept
Leicester Longwool seit 1760 – Vierhundert Jahre ohne Unterbrechung
Englands Erfolg basiert auf einem Fundament, das die DDR nie haben konnte: Kontinuität. Die Geschichte der englischen Longwool-Zucht beginnt 1760 mit Robert Bakewell und seinem revolutionären Leicester Longwool-Programm.
Bakewell entwickelte bereits im 18. Jahrhundert Zuchtmethoden, die heute noch Standard sind: systematische Selektion, Inzucht zur Festigung erwünschter Eigenschaften und präzise Dokumentation aller Zuchtschritte. Seine Methoden revolutionierten nicht nur die Schafzucht, sondern die gesamte Tierzucht.
Das Bemerkenswerte: Diese Tradition wurde nie unterbrochen. Seit 1760 arbeiten englische Züchter kontinuierlich an der Verbesserung ihrer Longwool-Schafe. Herdbücher existieren seit 1890 und dokumentieren lückenlos die Zuchtfortschritte über mehr als ein Jahrhundert.
Moderne Rassen wie das Wensleydale (seit 1839) haben alle ihre Wurzeln in diesen englischen Zuchtprogrammen. Praktisch alle hochwertigen Longwool-Rassen weltweit gehen auf englische Genetik zurück.
Bradford als Wollzentrum der Welt
Bradford entwickelte sich zum unangefochtenen Wollzentrum der Welt – und blieb es bis heute. Die Stadt baute eine jahrhundertealte Verarbeitungstradition auf, die niemals unterbrochen wurde.
Hier entstanden spezialisierte Techniken für die Longwool-Verarbeitung: die berühmten Wollkämme-Verfahren, mit denen die langen Fasern optimal aufbereitet werden. Diese Technik beherrschen heute nur noch wenige Standorte weltweit – Bradford ist einer davon.
Die systematische Wollsortierung nach internationalen Standards wurde in Bradford perfektioniert. Jede Wollpartie wird nach Dutzenden von Kriterien klassifiziert: Feinheit, Stapellänge, Kräuselung, Farbe, Festigkeit. Diese Sortierung ist die Grundlage für hochwertige Textilien.
Das Ergebnis: 15-25 Zentimeter Stapellänge
Die kontinuierliche Zuchtarbeit zeigt Ergebnisse: Englische Longwool-Schafe erreichen Stapellängen von 15-25 Zentimetern. Deutsche Schafe kommen durchschnittlich nur auf 8-12 Zentimeter.
Diese längeren Stapel ermöglichen die Herstellung von Worsted-Garnen – seidig glänzenden, festen Garnen für hochwertige Textilien. Kurze deutsche Wolle eignet sich hauptsächlich für Woolen-Garne, die weniger wertvoll sind.
England zeigt: Erfolgreiche Wollproduktion braucht Kontinuität, Spezialisierung und komplette Wertschöpfungsketten. Unterbrechungen sind fatal – Wiederaufbau dauert Generationen.

DACH-Comeback: Die Puzzleteile sind vorhanden
Schweiz: Pionierarbeit mit Swisswool
Die Schweiz macht vor, wie ein modernes Woll-Revival aussehen könnte. Mit 360.000 Schafen hat das Land eine solide Basis und zeigt, dass staatliche Förderung funktioniert.
Die Swisswool-Initiative etabliert ein Qualitätslabel für heimische Wolle. Das Bundesamt für Landwirtschaft unterstützt innovative Wollprojekte mit gezielter Forschungsförderung. Hier entstehen Pilotprojekte für hochwertige Nischenmärkte: Dämmstoffe aus Schafwolle, technische Textilien für Outdoor-Ausrüstung, Luxusprodukte für den wachsenden Markt nachhaltiger Mode.
Das große Problem der Schweiz: Die Infrastruktur fehlt. Schweizer Wolle muss zur Wäsche nach Belgien transportiert werden – ein logistischer und ökonomischer Unsinn. Eine regionale Wollwäscherei könnte hier die Wende bringen und die Wertschöpfung in der Schweiz halten.
Österreich: Lehner Wool als Erfolgsmodell
Österreich zeigt mit Lehner Wool, dass regionale Wollverarbeitung im DACH-Raum funktioniert. Das Unternehmen ist der größte Wollverarbeiter der Region und hat bewiesen, dass hochwertige Tierfasern regional und profitabel verarbeitet werden können.
Besonders der Erfolg mit Alpakawolle zeigt das Potential. Alpakafaser wird in Österreich von der Schur über die Verarbeitung bis zum Endprodukt abgewickelt. Die gesamte Wertschöpfungskette bleibt im Land – genau das, was auch für Schafwolle möglich wäre.
Das Schafwollzentrum Ötztal sammelt bereits Wolle von 400 Schafhaltern und zeigt, wie regionale Organisation funktioniert. Tiroler Bergschaf-Wolle mit 30-32 Mikron ist industriell verwertbar. Das Osttiroler Steinschaf liefert naturfarbige Premium-Wolle für Nischenmärkte.
Deutschland: 6.000 Tonnen ungenutztes Potential
Deutschland hat das größte Rohstoffpotential im DACH-Raum. 6.000 Tonnen Rohwolle jährlich, nach der Wäsche bleiben 4.200 Tonnen verwertbar. Bei 1,8 Millionen Schafen ist das eine solide Basis für Qualitätsverbesserungen.
Regionale Initiativen zeigen bereits Wege auf: Nordwolle aus Norddeutschland, Locwool aus Bayern, mährle Wolle aus Baden-Württemberg. Diese Projekte beweisen, dass deutsche Verbraucher bereit sind, für regionale Qualität zu zahlen. Natürlich nicht zu vergessen, die vielen kleineren regionale Unternehmen in unseren Verzeichnis.
Das Entscheidende: Die DDR-Genetik ist nicht verschwunden. In vielen ostdeutschen Herden schlummert noch das genetische Material der Merinolangwoll-Zucht. Mit modernen Zuchtmethoden könnte diese Basis reaktiviert werden.

Der Masterplan: Realismus trifft Utopie
Ein Comeback ist ein Mix aus Realismus und Utopie, wie ich aus zehn Jahren Arbeit mit regionaler Wolle weiß. Die Rassen wurden rausgezüchtet und auf Fleisch fokussiert – es wird schwer, sich wieder in die andere Richtung zu konzentrieren.
Aber wir haben weiterhin tolle Schafrassen, die für bestimmte Projekte optimale Wolle geben. Um international wieder ein Wort mitzureden, braucht es allerdings Geld, Willen, Fokus und Zeit.
Alle drei DACH-Nationen hätten auf ihre Art verschiedene Chancen zum Erfolg. Aber wie man so schön sagt: Zusammen ist man stärker. Das sollten wir in Betracht ziehen.
1. Infrastruktur-Offensive als Fundament
Der DACH-Raum braucht mindestens zwei bis drei regionale Wollwäschereien, um unabhängig von Belgien und Italien zu werden. Standorte könnten in Deutschland, Österreich und der Schweiz entstehen – jeweils optimiert für die regionalen Wollqualitäten.
Zusätzlich müssen Kämmereien entstehen, spezialisiert auf Longwool-Verarbeitung nach englischem Vorbild. Die Technologie dafür existiert – sie muss nur wieder implementiert werden.
Eine einheitliche Qualitätsklassifizierung nach australischem oder englischem Standard würde Transparenz schaffen. Deutsche Wolle bräuchte klare Qualitätsklassen, damit Verarbeiter und Verbraucher wissen, was sie kaufen.
2. Zuchtprogramm 2.0: DDR-Wissen trifft moderne Technik
Das Merinolangwoll der DDR könnte systematisch wiederaufgebaut werden – diesmal mit genomischer Selektion statt analoger Zuchtbücher. Die genetischen Marker für Wollqualität sind heute bekannt und messbar.
Zusätzliche Einkreuzung englischer Longwool-Genetik würde die Stapellänge von aktuell 8-12 auf 15-25 Zentimeter steigern. Leicester-, Lincoln- und Wensleydale-Böcke könnten importiert werden, um die deutsche Genetik aufzufrischen.
Künstliche Besamung, in der DDR bereits Standard, könnte flächendeckend wieder eingeführt werden. Moderne Zuchtmethoden ermöglichen schnelleren Fortschritt als damals möglich war.
3. Wirtschaftliche Anreize: Qualität muss sich lohnen
Statt 50 Cent pro Kilogramm müssen Qualitätsprämien von 5-10 Euro für hochwertige Wolle gezahlt werden. Nur wenn Qualität sich wirtschaftlich lohnt, werden Schäfer investieren.
Direktvermarktung und regionale Wertschöpfungsketten können Premium-Märkte erschließen: Luxustextilien für den wachsenden Markt nachhaltiger Mode, technische Anwendungen für Outdoor-Ausrüstung, Spezialtextilien für Nischenmärkte.
4. Wissenstransfer: Schäferschulen und England-Kooperationen
Schäferschulen nach dem Wettiner Vorbild müssen wiederaufgebaut werden. Hier könnte modernes Wissen über Zucht, Haltung und Wollproduktion vermittelt werden.
Kooperationen mit britischen Longwool-Züchtern könnten das verlorene Know-how zurückbringen. Austauschprogramme, gemeinsame Forschungsprojekte und Wissenstransfer würden beiden Seiten nutzen.
Universitäre Forschungsprogramme für Schafzucht und Wollverarbeitung würden das Fundament für langfristigen Erfolg schaffen. Deutschland hatte einmal führende Expertise – diese könnte reaktiviert werden.

2025: Das Jahr des Comebacks?
Die DDR bewies: Deutsche Züchter können Weltklasse-Wollqualität erreichen. 6 Kilogramm Wolle pro Schaf, 22-28 Mikron Finesse, systematische Zucht auf höchstem Niveau – das alles war einmal deutsche Realität.
Diese Erfolgsgeschichte ist zu wertvoll, um vergessen zu werden. Sie zeigt, was möglich ist, wenn Wille, Wissen und Ressourcen systematisch gebündelt werden.
Mit modernen Zuchtmethoden, koordiniertem Vorgehen und ausreichenden Investitionen könnte der DACH-Raum in 10-15 Jahren wieder zu den führenden Wollregionen Europas gehören. Die Bausteine sind vorhanden: Schweizer Innovation, österreichische Verarbeitung, deutsches Volumen – und das wiederentdeckte Wissen der DDR-Zeit.
Das Zeitfenster ist günstig: Nachhaltigkeit ist im Mainstream angekommen, regionale Kreisläufe sind politisch gewollt, Naturfasern erleben eine Renaissance. 2025 könnte tatsächlich das Jahr werden, in dem das große Woll-Comeback beginnt.
Deine Meinung ist gefragt
Was denkst du über diese Pläne für ein DACH-Woll-Comeback? Siehst du realistische Chancen oder ist das zu utopisch? Kennst du weitere spannende Geschichten aus der Wollproduktion, die erzählt werden sollten?
Oder hast du eigene Erfahrungen mit regionaler Wolle gemacht – als Schäfer, Verarbeiter oder Verbraucher? Schreib es in die Kommentare – ich sammle alle Hinweise und Geschichten für weitere Artikel.
Denn eines ist klar: Es gibt noch viel mehr zu entdecken in der Geschichte deutscher Wollproduktion. Und vielleicht auch in ihrer Zukunft.
Dies ist Teil 2 der Serie über deutsche Wollgeschichte. Teil 1: „Das vergessene DDR-Wollwunder“ erzählt die faszinierende Erfolgsgeschichte der DDR-Wollproduktion.